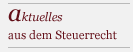Steuerinformation Januar 2025
Alle Steuerzahler
Eine Betriebsprüfung ist auch nach dem Tod des Geschäftsinhabers zulässig
| Eine Betriebsprüfung für zurückliegende Besteuerungszeiträume ist auch zulässig, wenn der Inhaber verstorben ist und der Betrieb von den Erben nicht weitergeführt wird. Das hat das Finanzgericht Hessen entschieden. |
Sachverhalt |
|
Geklagt hatten zwei Söhne, die jeweils Miterbe nach ihrem verstorbenen Vater geworden waren. Der Vater betrieb bis zu seinem Tod ein Bauunternehmen. Obwohl der Betrieb von den Söhnen nicht weitergeführt wurde, ordnete das Finanzamt eine Betriebsprüfung für mehrere zurückliegende Jahre an.
Die Söhne waren der Ansicht, dass eine Betriebsprüfung nur erfolgen dürfe, solange der Inhaber selbst Auskünfte zu der betrieblichen Tätigkeit geben könne und der Betrieb noch existiere. Eine Betriebsprüfung nach dem Tod des Betriebsinhabers sei unzulässig. Das Finanzgericht Hessen teilte diese Auffassung aber nicht. |
Die steuerlichen Pflichten gehen mit dem Tod des Betriebsinhabers auf die Erben über. Dazu gehört auch die Duldung der Betriebsprüfung. Mögliche Schwierigkeiten in Bezug darauf, dass bestimmte Auskünfte nicht erteilt oder Unterlagen nicht vorgelegt werden können, sind nicht bei der Frage der Zulässigkeit einer Außenprüfung zu berücksichtigen. Dies sind Umstände, die im späteren Besteuerungsverfahren auf Ebene der Beweisführung Bedeutung erlangen.
Beachten Sie | Da das Finanzgericht keine Revision zugelassen hat, wurde Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesfinanzhof eingelegt.
Quelle | FG Hessen, Urteil vom 10.5.2023, Az. 8 K 816/20, NZB BFH Az. X B 73/23, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 240802
Erbschaftsteuer: Bestattungskosten als Nachlassverbindlichkeiten und Freibeträge
| Leistungen aus einer Sterbegeldversicherung, die der Erblasser bereits zu Lebzeiten an ein Bestattungsunternehmen abgetreten hat, erhöhen als Sachleistungsanspruch der Erben den Nachlass. Im Gegenzug sind jedoch die Bestattungskosten in vollem Umfang als Nachlassverbindlichkeiten steuermindernd zu berücksichtigen. In einem weiteren Urteil hat der Bundesfinanzhof Folgendes klargestellt: Verzichtet ein Kind gegenüber einem Elternteil auf seinen gesetzlichen Erbteil, dann hat dieser Verzicht nicht zur Folge, dass beim Versterben des Elternteils die Enkel des Erblassers den Freibetrag i. H. von 400.000 EUR erhalten. Vielmehr erhält der Enkel nur einen Freibetrag i. H. von 200.000 EUR. |
Bestattungskosten bei Sterbegeldversicherung
Über folgenden Fall musste der Bundesfinanzhof jüngst entscheiden:
Sachverhalt |
|
Der Kläger und seine Schwester sind Erben ihrer verstorbenen Tante (Erblasserin). Diese hatte eine Sterbegeldversicherung abgeschlossen und das Bezugsrecht an ein Bestattungsunternehmen zur Deckung ihrer Bestattungskosten abgetreten. Nach dem Tod stellte das Bestattungsinstitut für seine Leistungen einen Betrag i. H. von 11.654 EUR in Rechnung. Davon bezahlte die Sterbegeldversicherung 6.864 EUR.
Das Finanzamt setzte gegen den Kläger Erbschaftsteuer fest und rechnete den Sachleistungsanspruch auf Bestattungsleistungen (6.864 EUR) zum Nachlass. Für die geltend gemachten Nachlassverbindlichkeiten (einschließlich der Kosten für die Bestattung) setzte es nur die Pauschale für Erbfallkosten nach § 10 Abs. 5 Nr. 3 S. 2 des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes (ErbStG) i. H. von 10.300 EUR an. Die nach dem Einspruchsverfahren erhobene Klage wies das Finanzgericht Münster als unbegründet zurück.
Der Bundesfinanzhof hat das Urteil aufgehoben und die Sache an das Finanzgericht zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen. |
Aufgrund der von der Erblasserin abgeschlossenen Sterbegeldversicherung ist ein Sachleistungsanspruch in Bezug auf die Bestattung auf die Erben übergegangen. Dieser fiel (wie das Finanzgericht zutreffend entschieden hat) in Höhe der Versicherungsleistung von 6.864 EUR in den Nachlass und erhöhte die Bemessungsgrundlage der Erbschaftsteuer.
Im Unterschied zum Finanzgericht Münster ist der Bundesfinanzhof aber der Meinung, dass die Bestattungskosten nicht nur in Höhe der Pauschale von 10.300 EUR abzugsfähig sind. Sie sind vielmehr in vollem Umfang als Nachlassverbindlichkeiten bei der Bemessung der Erbschaftsteuer steuermindernd zu berücksichtigen. Da die Feststellungen des Finanzgerichts nicht ausreichten, um die Höhe der insgesamt zu berücksichtigenden Nachlassverbindlichkeiten zu bestimmen, wurde das Verfahren zurückverwiesen.
MERKE | Durch das Jahressteuergesetz 2024 wurde der Erbfallkostenpauschbetrag von 10.300 EUR auf 15.000 EUR erhöht. Nach der Gesetzesbegründung soll so ein individueller Kostennachweis in der Mehrzahl der Fälle vermieden werden können. Die Erhöhung gilt für Erwerbe, für die die Steuer ab dem Monat entsteht, der der Gesetzesverkündung folgt. |
Freibeträge
Hintergrund: Je näher das verwandtschaftliche Verhältnis ist, umso höher ist bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer der Freibetrag nach § 16 Abs. 1 ErbStG. So gelten für Kinder 400.000 EUR. Dieser Betrag gilt auch für die Enkelkinder, sofern die Kinder des Erblassers bereits vorher gestorben sind. Bei Enkeln, deren Eltern noch leben, beträgt der Freibetrag 200.000 EUR.
Sachverhalt |
Im Streitfall hatte der Vater des Klägers gegenüber seinem eigenen Vater (dem Großvater des Klägers) vertraglich auf sein gesetzliches Erbrecht verzichtet. Als der Großvater verstarb, wurde sein Enkel gesetzlicher Erbe. |
|
Dieser beantragte beim Finanzamt, ihm für die Erbschaft einen Freibetrag i. H. von 400.000 EUR zu gewähren. Das Finanzamt bewilligte aber nur einen Freibetrag i. H. von 200.000 EUR, da sein eigener Vater zwar auf seinen gesetzlichen Erbteil verzichtet hatte, aber beim Tod des Großvaters noch lebte.
Die Klage vor dem Finanzgericht Niedersachsen war ebenso erfolglos, wie die Revision beim Bundesfinanzhof. |
Der Wortlaut des § 16 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 ErbStG benennt als Empfänger des höheren Freibetrags „Kinder verstorbener Kinder“. Diese Formulierung ist dahin gehend zu verstehen, dass die Kinder des Erblassers tatsächlich verstorben sind. Die Vorversterbensfiktion des § 2346 Abs. 1 S. 2 BGB bewirkt nicht, dass das erbverzichtende Kind als „verstorbenes Kind“ im Sinne des § 16 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 ErbStG gilt und dessen Abkömmlinge den Freibetrag i. H. von 400.000 EUR erhalten.
Die Freibetragsregelungen sollen die Abkömmlinge der ersten Generation (Kinder) begünstigen. Bei den Enkeln hat der Gesetzgeber die familiäre Verbundenheit nicht als so eng angesehen und gewährt somit einen geringeren Freibetrag (200.000 EUR). Lediglich wenn die eigene Elterngeneration vorverstorben ist, sieht der Gesetzgeber die Großeltern für das Auskommen der „verwaisten Enkel“ in der Pflicht und gewährt ihnen den höheren Freibetrag von 400.000 EUR.
Beachten Sie | Eine Ausdehnung des höheren Freibetrags auf Kinder, die nur vom Gesetz als verstorben angesehen werden, die aber tatsächlich bei Tod des Großelternteils noch leben, hat der Gesetzgeber nicht gewollt.
Quelle | Nachlassverbindlichkeiten: BFH-Urteil vom 10.7.2024, Az. II R 31/21, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 244791; BFH, PM Nr. 43/24 vom 14.11.2024; Freibeträge: BFH-Urteil vom 31.7.2024, Az. II R 13/22, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 244795; BFH, PM Nr. 41/24 vom 14.11.2024
Gesetzliche Krankenversicherung: Zusatzbeitragssatz steigt 2025 auf 2,5 %
| Der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz in der gesetzlichen Krankenversicherung wird mit Wirkung ab 2025 um 0,8 % auf 2,5 % angehoben (BAnz AT 7.11.24 B4). Allerdings ist dies nur ein Orientierungswert. Den tatsächlichen Zusatzbeitragssatz bestimmt jede Krankenkasse individuell. |
Beispiel: Bei einem monatlichen Bruttoeinkommen von 3.000 EUR bewirkt eine Erhöhung um 0,8 %, dass der Nettolohn um 12 EUR sinkt. Da der Zusatzbeitrag paritätisch getragen wird, zahlt der Arbeitgeber die anderen 12 EUR.
Energetische Gebäudesanierung: Steuerermäßigung erst bei vollständiger Bezahlung
| Zum 1.1.2020 wurde mit § 35c Einkommensteuergesetz (EStG) eine Steuerermäßigung für energetische Maßnahmen bei zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäuden eingeführt. Der Bundesfinanzhof hat sich nun erstmals mit dieser Vorschrift befasst und dabei Folgendes zu einer Ratenzahlung entschieden: Die Steuerermäßigung kann erst dann gewährt werden, wenn die Montage vorgenommen und der Rechnungsbetrag vollständig auf das Konto des Installationsunternehmens bezahlt wurde. |
Hintergrund
Die Steuerermäßigung setzt u. a. voraus, dass das Objekt bei der Durchführung der Maßnahme älter als zehn Jahre ist (maßgebend ist der Herstellungsbeginn).
Begünstigte Aufwendungen bzw. Maßnahmen sind u. a.:
- Wärmedämmung von Wänden, Dachflächen und Geschossdecken,
- Erneuerung der Fenster, Außentüren oder der Heizungsanlage.
Je begünstigtem Objekt beträgt der Höchstbetrag der Steuerermäßigung 40.000 EUR, wobei die Ermäßigung nach Maßgabe des § 35c Abs. 1 EStG über drei Jahre verteilt wird.
Sachverhalt |
|
2021 hatte ein Ehepaar die Heizung des selbst bewohnten Einfamilienhauses durch den Einbau eines neuen Gasbrennwertheizkessels modernisiert. Die Kosten für die Lieferung und die Montage des Kessels betrugen rund 8.000 EUR. In der Rechnung waren auch Kosten für Monteurstunden und Fachhelferstunden enthalten.
Seit März 2021 zahlte das Ehepaar gleichbleibende monatliche Raten in Höhe von 200 EUR auf den Rechnungsbetrag. Infolgedessen wurden im Streitjahr 2021 insgesamt 2.000 EUR bezahlt. Die im Zuge der Einkommensteuererklärung beantragte Steuerermäßigung nach § 35c EStG lehnte das Finanzamt jedoch ab, da diese erst mit Begleichung der letzten Rate im Jahr 2024 in Betracht komme.
Dieser Ansicht schlossen sich das Finanzgericht München und der Bundesfinanzhof an. |
Nach § 35c Abs. 4 Nr. 1 EStG muss der Steuerpflichtige eine Rechnung in deutscher Sprache mit bestimmten inhaltlichen Angaben erhalten haben. Zusätzlich verlangt § 35c Abs. 4 Nr. 2 EStG ausdrücklich, dass die Zahlung auf das Konto des Erbringers der Leistung erfolgt ist.
Bevor die Rechnung nicht vollständig beglichen worden ist, liegt der von § 35c Abs. 1 EStG geforderte Abschluss der Maßnahme noch nicht vor. Demzufolge kann für die geleisteten Teilzahlungen im Jahr 2021 keine Steuerermäßigung gewährt werden.
|
MERKE | Der Bundesfinanzhof weist abschließend darauf hin, dass im Streitjahr 2021 eine Steuerermäßigung nach § 35a Abs. 3 EStG für Handwerkerleistungen in Betracht kommt (20 % der Aufwendungen, höchstens jedoch 1.200 EUR). Nach dieser Vorschrift werden allerdings nur die Arbeitskosten und nicht auch die Materialkosten begünstigt.
Nimmt der Steuerpflichtige die Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen in Anspruch, dann ist eine (zusätzliche) Förderung auf der Grundlage des § 35c EStG allerdings ausgeschlossen. |
Quelle | BFH-Urteil vom 13.8.2024, Az. IX R 31/23, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 244201; BFH, PM Nr. 39/24 vom 10.10.2024
Vermieter
DSGVO: Finanzamt darf Mietverträge anfordern
| Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs darf das Finanzamt einen Steuerpflichtigen auch unter Berücksichtigung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zur Vorlage der Mietverträge zum Zwecke der Prüfung der in der Steuererklärung gemachten Angaben auffordern. |
Sachverhalt |
|
Im Zuge der Steuererklärung forderte das Finanzamt Kopien der aktuellen Mietverträge, Nebenkostenabrechnungen sowie Nachweise über geltend gemachte Erhaltungsaufwendungen an.
Der Steuerpflichtige bzw. der Vermieter legte zwar eine Aufstellung der Brutto- und Nettomieteinnahmen mit geschwärzten Namen der Mieter sowie der Betriebskosten für die verschiedenen Wohnungen und Unterlagen über die Instandhaltungsaufwendungen vor, jedoch nicht die angeforderten Mietverträge und Nebenkostenabrechnungen. Der Grund: Die Offenlegung sei im Hinblick auf die DSGVO ohne vorherige Einwilligung der Mieter nicht möglich. Das Finanzamt, das Finanzgericht Nürnberg und der Bundesfinanzhof waren aber anderer Ansicht. |
Nach § 97 Abs. 1 S. 1 der Abgabenordnung haben die Beteiligten und andere Personen der Finanzbehörde auf deren Verlangen Bücher, Aufzeichnungen, Geschäftspapiere und andere Urkunden zur Einsicht und zur Prüfung vorzulegen.
Die Vorlage von Urkunden unterliegt dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Die Vorlage muss also zur Sachverhaltsaufklärung geeignet und notwendig, die Pflichterfüllung für den Betroffenen möglich und die Inanspruchnahme erforderlich, verhältnismäßig und zumutbar sein. Dies war für den Bundesfinanzhof hier der Fall. Er führte weiter aus:
- Eine Einwilligung der Mieter in die Weitergabe an das Finanzamt ist nicht erforderlich, weil die Verarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 Unterabs. 1 Buchst. c DSGVO gerechtfertigt ist.
- Die Übersendung der Mietverträge ist als Zweckänderung nach Art. 6 Abs. 4 DSGVO regelmäßig zulässig.
Quelle | BFH-Urteil vom 13.8.2024, Az. IX R 6/23, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 244406
Vorfälligkeitsentschädigung als Werbungskosten
| Wird ein zur Finanzierung eines vermieteten Grundstücks aufgenommenes Darlehen unter Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung getilgt, ist die Vorfälligkeitsentschädigung als Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung abziehbar. Das gilt nach einem Urteil des Finanzgerichts Niedersachsen zumindest dann, wenn das Grundstück weiterhin zur Vermietung genutzt wird. |
Sachverhalt |
|
Eheleute erzielten Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung aus insgesamt fünf Vermietungsobjekten. Dazu gehörten die Objekte X1 und X2.
Für die im Jahr 2013 erfolgte Anschaffung der beiden Objekte wurden zwei Darlehen aufgenommen. Ein Darlehen über 200.000 EUR diente der Finanzierung des Objekts X1. Mit dem anderen Darlehen über 195.000 EUR wurde das Objekt X2 finanziert. Eine den Eheleuten ebenfalls gehörende Immobilie Y diente der Bank als Zusatzsicherheit. Die Immobilie Y wurde von den Eheleuten zunächst selbst bewohnt und diente anschließend zur Erzielung von Vermietungseinkünften.
Im Streitjahr 2020 veräußerten die Eheleute die Immobilie Y. Im Zuge dieser Veräußerung lösten sie auch die beiden Darlehen für die Objekte X1 und X2 ab. Denn die Bank war nicht bereit, den Wegfall des „Sicherungsobjekts Y“ hinzunehmen oder durch eine andere Sicherung zu ersetzen. Dafür fielen Vorfälligkeitsentschädigungen an (4.338 EUR und 4.280 EUR).
In der Steuererklärung für 2020 wich das Finanzamt von den Angaben der Eheleute ab, u. a. berücksichtigte es die Vorfälligkeitsentschädigungen nicht als Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung, weil die Vorfälligkeitsentschädigungen in einem wirtschaftlichen Zusammenhang mit der Veräußerung der Immobilie Y stünden. Das Finanzgericht Niedersachsen sah das aber anders. |
Schuldzinsen sind als Werbungskosten abzugsfähig, soweit sie mit einer Einkunftsart in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. Der Begriff der Schuldzinsen umfasst auch eine zur vorzeitigen Ablösung eines Darlehens gezahlte Vorfälligkeitsentschädigung. Denn Vorfälligkeitsentschädigungen sind ein Nutzungsentgelt für das auf die verkürzte Laufzeit in Anspruch genommene Fremdkapital.
Wird ein zur Finanzierung eines vermieteten Grundstücks aufgenommenes Darlehen unter Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung getilgt, das Grundstück jedoch weiterhin zur Vermietung genutzt, ist die Vorfälligkeitsentschädigung als Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung abziehbar.
Im Streitfall standen die beiden Darlehen niemals in einem Veranlassungszusammenhang mit dem Objekt Y. Soweit der Bundesfinanzhof in seiner Rechtsprechung einen Veranlassungszusammenhang der Vorfälligkeitszinsen mit einer Veräußerung des Grundbesitzes sieht, so betrifft dies Fälle, in denen es um die Veräußerung des mit den Darlehen finanzierten Grundbesitzes geht.
Dies trifft für das Objekt Y jedoch nicht zu. Denn für dieses Objekt wurden die Darlehen ursprünglich nicht aufgenommen. Und durch die Veräußerung des nur als Sicherungsobjekt dienenden Grundstücks Y hat sich der Veranlassungszusammenhang nicht geändert.
Quelle | FG Niedersachsen, Urteil vom 30.10.2024, Az. 3 K 145/23; BFH-Urteil vom 11.2.2014, Az. IX R 42/13
Freiberufler und Gewerbetreibende
Informationen zur Durchführung von Kassen-Nachschauen
| Aus aktuellem Anlass hat die Oberfinanzdirektion Karlsruhe darauf hingewiesen, dass die Finanzämter in Baden-Württemberg Kassen-Nachschauen nach § 146b der Abgabenordnung (AO) durchführen. Folgende Aspekte sind zu beachten: |
Bei der Kassen-Nachschau handelt es sich um ein Kontrollinstrument der Finanzverwaltung zur Überprüfung der Ordnungsmäßigkeit von Kassenaufzeichnungen (Kasseneinnahmen, Kassenausgaben). Die Prüfung erfolgt in der Regel ohne Voranmeldung und wird von zwei Bediensteten der Finanzverwaltung durchgeführt. Die Prüfer weisen sich zu Beginn der Kassen-Nachschau mit ihren Dienstausweisen (im Scheckkarten- oder Papierformat) als Angehörige des Finanzamts aus und händigen ein Merkblatt zur Kassen-Nachschau aus.
Der Kassen-Nachschau unterliegen u. a. elektronische oder computergestützte Kassensysteme, App-Systeme, Waagen mit Registrierkassenfunktion, Taxameter, Wegstreckenzähler, Geldspielgeräte und offene Ladenkassen.
Die von der Kassen-Nachschau betroffenen Steuerpflichtigen haben den mit der Kassen-Nachschau betrauten Amtsträgern auf Verlangen Aufzeichnungen, Bücher sowie die für die Kassenführung erheblichen sonstigen Organisationsunterlagen über die der Kassen-Nachschau unterliegenden Sachverhalte und Zeiträume vorzulegen und Auskünfte zu erteilen. Bei der Kassen-Nachschau dürfen Daten des elektronischen Aufzeichnungssystems durch die Amtsträger eingesehen werden. Auch kann die Übermittlung von Daten auf einem maschinell auswertbaren Datenträger verlangt werden.
Beachten Sie | Die Prüfer verlangen von den Steuerpflichtigen keine Zahlungen von Bargeld.
Quelle | OFD Karlsruhe, Mitteilung vom 21.10.2024: „Durchführung von Kassen-Nachschauen nach § 146b Abgabenordnung (AO)“
Viertes Bürokratieentlastungsgesetz verkündet
| Am 29.10.2024 wurde das Vierte Bürokratieentlastungsgesetz im Bundesgesetzblatt verkündet (BGBl I 2024, Nr. 323). Aus steuerlicher Sicht hervorzuheben ist sicherlich die verkürzte Aufbewahrungsfrist für Buchungsbelege. |
Bislang galt eine Aufbewahrungsfrist für Buchungsbelege von grundsätzlich zehn Jahren. Diese Frist ist nun auf acht Jahre verkürzt worden (§ 147 Abs. 3 der Abgabenordnung und § 257 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs). Die Erleichterung gilt grundsätzlich bereits dann, wenn am Tag des Inkrafttretens des Gesetzes (1.1.2025) die bisherige 10-Jahres-Frist noch nicht abgelaufen war.
Auch die umsatzsteuerliche Frist zur Aufbewahrung von Rechnungen in § 14b Abs. 1 S. 1 Umsatzsteuergesetz (UStG) wurde an die neue Frist angepasst. Die Entlastung gilt grundsätzlich für alle Rechnungen, deren Aufbewahrungsfrist am 31.12.2024 noch nicht abgelaufen ist.
Ab 2025 werden die Schwellenwerte bei den Umsatzsteuer-Voranmeldungen von 7.500 EUR auf 9.000 EUR angehoben. Wird der Schwellenwert nicht überschritten, muss die Voranmeldung nur vierteljährlich abgegeben werden.
Quelle | Viertes Bürokratieentlastungsgesetz, BGBl I 2024, Nr. 323
Umsatzsteuerzahler
Elektronische Rechnungen: Finales Anwendungsschreiben veröffentlicht
| Für nach 2024 ausgeführte Umsätze gilt die obligatorische elektronische Rechnung (kurz E-Rechnung) bei Umsätzen zwischen inländischen Unternehmern. Bereits im Juni 2024 hatte das Bundesfinanzministerium ein Anwendungsschreiben im Entwurf veröffentlicht und den Verbänden mit der Gelegenheit zur Stellungnahme übersandt. Nun liegt das finale Schreiben mit 18 Seiten vor. |
Allgemeines und Übergangsregelungen
Durch das Wachstumschancengesetz (BGBl I 2024, Nr. 108) wurden die Regelungen zur Ausstellung von Rechnungen nach § 14 Umsatzsteuergesetz (UStG) für nach 2024 ausgeführte Umsätze neu gefasst. Kernpunkt der Neuregelung: Die obligatorische E-Rechnung bei Umsätzen zwischen inländischen Unternehmern (inländische B2B-Umsätze).
Ausgenommen sind Rechnungen über Leistungen, die nach § 4 Nr. 8 bis 29 UStG steuerfrei sind, sowie Rechnungen über Kleinbeträge bis 250 EUR (§ 33 der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung (UStDV)) und Fahrausweise (§ 34 UStDV).
Da die Umsetzung einige Zeit beanspruchen wird, sind nach den Vorgaben des § 27 UStG Übergangsregeln nutzbar:
- Der allgemeine Übergangszeitraum beträgt zwei Jahre (Pflicht somit ab 2027).
- Drei Jahre gelten für Unternehmer mit einem Gesamtumsatz von bis zu 800.000 EUR im Jahr 2026.
MERKE | Hinsichtlich des Empfangs einer E-Rechnung gilt allerdings keine Übergangsregelung, er ist somit vom 1.1.2025 an durch den Rechnungsempfänger zu gewährleisten. Hierfür reicht es aus, wenn der Empfänger ein E-Mail-Postfach zur Verfügung stellt. |
Dabei ist es nicht erforderlich, dass es sich um ein gesondertes E-Mail-Postfach nur für den Empfang von E-Rechnungen handelt. Die Beteiligten können abweichend hiervon auch andere zulässige Übermittlungswege vereinbaren.
Ausgewählte Aspekte und Nachbesserungen zum Entwurf
Das Bundesfinanzministerium widmet sich sehr ausführlich der Frage nach den zulässigen Formaten. Generell gilt: E-Rechnungen können sowohl in einem rein strukturierten als auch in einem hybriden Format erstellt werden.
Ein zulässiges elektronisches Rechnungsformat muss vor allem gewährleisten, dass die Rechnungsangaben nach §§ 14, 14a UStG elektronisch übermittelt und ausgelesen werden können. Die Verwendung von strukturierten Formaten, die der Normenreihe EN 16931 entsprechen, ist immer zulässig.
Als Beispiele für zulässige nationale elektronische Rechnungsformate nennt das Bundesfinanzministerium Rechnungen nach dem Standard XRechnung und nach dem ZUGFeRD-Format ab der Version 2.0.1 (ausgenommen die Profile MINIMUM und BA-SIC-WL).
Beachten Sie | Auch europäische Formate sind zulässig, z. B. Factur-X (Frankreich).
Auf welches zulässige elektronische Rechnungsformat und welchen zulässigen Übermittlungsweg sich die Vertragsparteien einigen, ist zivilrechtlich zwischen ihnen zu klären. Für die Übermittlung von E-Rechnungen kommen z. B. der Versand per E-Mail (Achtung: Eine PDF ist keine E-Rechnung), die Bereitstellung der Daten mittels einer elektronischen Schnittstelle, der gemeinsame Zugriff auf einen zentralen Speicherort innerhalb eines Konzernverbundes oder die Möglichkeit des Downloads über ein Internetportal in Betracht.
Beachten Sie | Der Deutsche Steuerberaterverband (DStV) begrüßt, dass das Schreiben keine unnötigen Beschränkungen der Übermittlungswege mehr enthält. So ist etwa die noch im Entwurfsschreiben vorgesehene Maßgabe, dass ein USB-Stick kein zulässiger Weg ist, entfallen.
Darüber hinaus hat der DStV insbesondere folgende Anpassungen ausdrücklich positiv hervorgehoben:
- Vor dem 1.1.2027 ausgestellte Dauerrechnungen in Papierform oder als PDF behalten ihre Gültigkeit. Sie müssen entgegen dem Entwurf erst als E-Rechnung ausgestellt werden, wenn sich die Rechnungsangaben ändern.
- Bis zum Ablauf der Übergangsfristen zur Einführung der E-Rechnung können Unternehmer ihre Leistungen auch mit einer sonstigen Rechnung abrechnen (Papier, PDF- oder Worddatei). Muss diese Rechnung später korrigiert werden, kann dies in dem sonstigen Format erfolgen. Eine Pflicht zur Rechnungskorrektur mittels E-Rechnung besteht somit nur für Leistungen, die ohnehin mittels E-Rechnung abzurechnen sind.
Beachten Sie | Nach dem BMF-Schreiben betrifft die Pflicht zur Ausstellung von E-Rechnungen auch umsatzsteuerliche Kleinunternehmer (§ 19 UStG). Durch das Jahressteuergesetz 2024 (Zustimmung des Bundesrats ist für den 22.11.2024 anvisiert) soll diese Verpflichtung aber aufgehoben werden.
Quelle | BMF-Schreiben vom 15.10.2024, Az. III C 2 - S 7287-a/23/10001 :007, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 244405; DStV, Mitteilung vom 16.10.2024: „Finales BMF-Schreiben zur E-Rechnung: auch DStV-Anregungen wurden umgesetzt“
Arbeitgeber
Sonderleistungen: Bundesfinanzhof zu steuerfreier Corona-Sonderzahlung gefragt
| Konnte ein Arbeitgeber Sonderleistungen wie z. B. Urlaubsgeld (worauf arbeitsrechtlich kein Anspruch bestand) teilweise als steuerfreie Corona-Sonderzahlung nach § 3 Nr. 11a Einkommensteuergesetz auszahlen? Damit muss sich nun der Bundesfinanzhof in einem Revisionsverfahren mit dem Az. VI R 25/24 befassen. Vorgelegt hat das Finanzgericht Niedersachsen. Es hat auf sein steuerzahlernachteiliges Urteil (24.7.2024, Az. 9 K 196/22) die Revision zugelassen. |
Arbeitnehmer
Entfernungspauschale: Wann ist die tatsächlich benutzte längere Fahrtstrecke ansetzbar?
| Grundsätzlich kann die Entfernungspauschale nur für die kürzeste Entfernung beansprucht werden. Etwas anderes gilt aber, wenn eine andere Verbindung offensichtlich verkehrsgünstiger ist und vom Arbeitnehmer regelmäßig benutzt wird (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 S. 4 Einkommensteuergesetz). Wann dies der Fall ist, musste jüngst das Finanzgericht Niedersachsen entscheiden. |
Hintergrund
Für die Fahrten zwischen der Wohnung und der ersten Tätigkeitsstätte können Steuerpflichtige die Entfernungspauschale steuermindernd als Werbungskosten ansetzen. Für 2022 bis 2026 gilt ab dem 21. Entfernungskilometer eine erhöhte Entfernungspauschale i. H. von 0,38 EUR. Für die ersten 20 Kilometer erfolgte allerdings keine Anpassung. Hier gelten somit weiterhin 0,30 EUR.
Entscheidung
Eine Straßenverbindung ist dann als verkehrsgünstiger als die kürzeste Verbindung zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte anzusehen, wenn der Arbeitnehmer eine andere (längere) Straßenverbindung nutzt und er die Arbeitsstätte auf diese Weise trotz gelegentlicher Verkehrsstörungen in der Regel schneller und pünktlicher erreicht.
„Offensichtlich” verkehrsgünstiger ist die vom Arbeitnehmer gewählte Straßenverbindung dann, wenn ihre Vorteilhaftigkeit so auf der Hand liegt, dass sich auch ein unvoreingenommener, verständiger Verkehrsteilnehmer unter den gegebenen Verkehrsverhältnissen für die Benutzung der Strecke entschieden hätte. Dass bei extremen Stauverhältnissen die Umwegstrecke auch mal verkehrsgünstiger und schneller sein kann, reicht insoweit nicht aus.
Allein die höhere Zahl der Ampeln und die erforderliche Fahrt durch die Innenstadt bei Benutzung der kürzeren Strecke kommen im Rahmen der Würdigung aller Umstände des Einzelfalls keine entscheidende Bedeutung zu. Das Finanzgericht Niedersachsen führte aus: Die Indizwirkung der nicht feststellbaren regelmäßigen Fahrzeitverkürzung der längeren Strecke bzw. die im Regelfall sogar erhebliche Fahrzeitverkürzung der kürzeren Strecke bei normaler üblicher Verkehrslage überlagert im Rahmen der Gesamtbewertung mögliche Beeinträchtigungen durch Ampelschaltungen oder Innenstadtfahrten.
Krankheitsgründe können grundsätzlich gegen die Zumutbarkeit der Benutzung der kürzeren Fahrtstrecke sprechen (Entscheidung des Finanzgerichts Hamburg bei amtsärztlich attestierter Höhenangst und Fahrt über eine Brücke).
Beachten Sie | Die im Streitfall nicht weiter belegte erhöhte Unfallgefahr auf der kürzeren Fahrtstrecke sowie eine dargelegte Erforderlichkeit von planbaren Pausen wegen Rückenleidens bzw. Schwerbehinderung reichen allerdings nicht aus, damit die Benutzung der kürzeren Fahrtstrecke als unzumutbar angesehen werden kann. Dies gilt zumindest, wenn der Steuerpflichtige (wie im Streitfall) infolge eines Standortwechsels des Arbeitgebers in einem späteren Veranlagungszeitraum einen Großteil der kürzeren Fahrtstrecke dann tatsächlich nutzt.
Quelle | FG Niedersachsen, Urteil vom 3.4.2024, Az. 9 K 117/21, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 243441; FG Hamburg, Urteil vom 24.3.2003, Az. II 61/02
Abschließende Hinweise
Steuern und Beiträge Sozialversicherung: Fälligkeitstermine in 12/2024
| Im Monat Dezember 2024 sollten Sie insbesondere folgende Fälligkeitstermine beachten: |
Steuertermine (Fälligkeit):
- Umsatzsteuer (Monatszahler): 10.12.2024
- Lohnsteuer (Monatszahler): 10.12.2024
- Einkommensteuer (vierteljährlich): 10.12.2024
- Kirchensteuer (vierteljährlich): 10.12.2024
- Körperschaftsteuer (vierteljährlich): 10.12.2024
Bei einer Scheckzahlung muss der Scheck dem Finanzamt spätestens drei Tage vor dem Fälligkeitstermin vorliegen.
Beachten Sie | Die für alle Steuern geltende dreitägige Zahlungsschonfrist bei einer verspäteten Zahlung durch Überweisung endet am 13.12.2024. Es wird an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, dass diese Zahlungsschonfrist ausdrücklich nicht für Zahlung per Scheck gilt.
Beiträge Sozialversicherung (Fälligkeit):
Sozialversicherungsbeiträge sind spätestens am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig, für den Beitragsmonat Dezember 2024 am 23.12.2024.
Verzugszinsen
| Für die Berechnung der Verzugszinsen ist der Basiszinssatz nach § 247 BGB anzuwenden. Die Höhe wird jeweils zum 1.1. und 1.7. eines Jahres neu bestimmt. |
Der Basiszinssatz für die Zeit vom 1.7.2024 bis zum 31.12.2024 beträgt 3,37 Prozent.
Damit ergeben sich folgende Verzugszinsen:
- für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB): 8,37 Prozent
- für den unternehmerischen Geschäftsverkehr (§ 288 Abs. 2 BGB): 12,37 Prozent*
* für Schuldverhältnisse, die vor dem 29.7.2014 entstanden sind: 11,37 Prozent.
Die für die Berechnung der Verzugszinsen anzuwendenden Basiszinssätze betrugen in der Vergangenheit:
Berechnung der Verzugszinsen | |
Zeitraum |
Zins |
vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 |
3,62 Prozent |
vom 1.7.2023 bis 31.12.2023 |
3,12 Prozent |
vom 1.1.2023 bis 30.6.2023 |
1,62 Prozent |
vom 1.7.2022 bis 31.12.2022 |
-0,88 Prozent |
vom 1.1.2022 bis 30.6.2022 |
-0,88 Prozent |
vom 1.7.2021 bis 31.12.2021 |
-0,88 Prozent |
vom 1.1.2021 bis 30.6.2021 |
-0,88 Prozent |
vom 1.7.2020 bis 31.12.2020 |
-0,88 Prozent |
vom 1.1.2020 bis 30.6.2020 |
-0,88 Prozent |
vom 1.7.2019 bis 31.12.2019 |
-0,88 Prozent |
vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 |
-0,88 Prozent |
vom 1.7.2018 bis 31.12.2018 |
-0,88 Prozent |
Ergebnisse der steuerlichen Betriebsprüfung der Länder 2023
| Auf der Grundlage von Meldungen der Länder erstellt das Bundesfinanzministerium jährlich eine Statistik über die Ergebnisse der steuerlichen Betriebsprüfung der Länder. In den Betriebsprüfungen der Länder waren im Jahr 2023 bundesweit 12.394 Prüfer tätig. Es wurde ein Mehrergebnis von rund 13,2 Mrd. EUR festgestellt. |
Von den 8.409.661 Betrieben, die in der Betriebskartei der Finanzämter erfasst sind, wurden 146.516 Betriebe geprüft. Dies entspricht einer Prüfungsquote von 1,7 % im Durchschnitt. Bei den Großunternehmen betrug die Quote 17,8 %.
Ferner wurden 5.803 Prüfungen in sonstigen Fällen vorgenommen, u. a. bei Steuerpflichtigen mit bedeutenden Einkünften bzw. bei Verlustzuweisungsgesellschaften oder Bauherrengemeinschaften.
Quelle | BMF, Ergebnisse der steuerlichen Betriebsprüfung der Länder 2023, unter www.iww.de/s11885